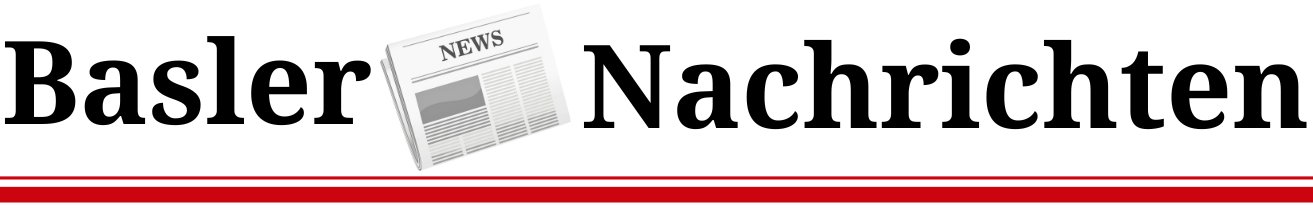Technologie im Alter könnte das Gehirn fördern
Zwei Universitäten aus Texas untersuchten frühere Studien, um den Einfluss lebenslanger Technologienutzung auf die geistige Gesundheit zu analysieren. Da nun die erste Generation mit dauerhafter digitaler Erfahrung ins Rentenalter kommt, wollten Experten wissen, wie sich die Bildschirmzeit auf das Denkvermögen ausgewirkt hat. Die Ergebnisse erschienen in Nature Human Behavior und prüfen die sogenannte „digitale Demenz-Hypothese“. Diese Theorie behauptet, dass Techniknutzung zu Abhängigkeit führt und die geistige Leistungsfähigkeit über die Jahre schwächt.
Dr. Amit Sachdev, medizinischer Leiter der Neurologie an der Michigan State University, erklärte, dass ein im jungen und mittleren Alter aktives Gehirn im Alter oft widerstandsfähiger bleibt. Er selbst war nicht an der Studie beteiligt.
Die Studienautoren fanden jedoch das Gegenteil der Hypothese heraus. Sie analysierten 57 Studien mit insgesamt 411.430 älteren Personen. Dabei stellten sie fest, dass Techniknutzung das Risiko kognitiver Störungen um 42 % senkte. Die Forscher erfassten sowohl klinische Diagnosen wie Demenz oder leichte Gedächtnisstörungen als auch niedrige Ergebnisse bei mentalen Tests.
Digitale Aktivität zeigt positive Wirkung auf das Alterungsgehirn
Untersucht wurden verschiedene digitale Werkzeuge: Internet, E-Mail, soziale Medien, Smartphones und Computer. Selbst nach Berücksichtigung von Bildung, Lebensstil und Einkommen blieb der Zusammenhang zwischen Technik und besserer geistiger Gesundheit bestehen. Dr. Jared Benge, Mitautor der Studie und Professor an der Universität von Texas in Austin, betonte, dass der Effekt nicht nur auf Hintergrundfaktoren zurückzuführen ist.
Die Forschenden durchsuchten acht Datenbanken nach Studien bis zum Jahr 2024. Ihre Hauptanalyse umfasste 20 Langzeitstudien mit durchschnittlich sechs Jahren Beobachtungsdauer sowie 37 Querschnittsstudien. Die Teilnehmenden waren im Schnitt 68 Jahre alt zu Beginn der Untersuchungen.
Insgesamt zeigte sich eine klare Verbindung zwischen Techniknutzung und geistiger Fitness – auch wenn die Ergebnisse zur Nutzung sozialer Medien uneinheitlich blieben. Keine der insgesamt 136 untersuchten Studien wies auf ein erhöhtes Risiko durch digitale Nutzung hin. Dr. Michael Scullin, Mitautor und Professor an der Baylor University, erklärte, wie ungewöhnlich eine derart durchgehende Übereinstimmung in der Forschung sei.
Dr. Christopher Anderson, Schlaganfallspezialist am Brigham and Women’s Hospital in Boston, lobte die Studie als sorgfältige Analyse von fast zwei Jahrzehnten Forschung. Er selbst war nicht beteiligt.
Maßvoller und sinnvoller Umgang bleibt entscheidend
Trotz der positiven Ergebnisse raten Fachleute von unbedachter Nutzung ab. Benge warnte, die Ergebnisse seien keine Freikarte für endloses Scrollen. Stattdessen zeigen sie, dass die Internetgeneration Wege gefunden hat, Technik zum Vorteil des Gehirns einzusetzen.
Viele Fragen bleiben offen. So fehlen der Studie genaue Informationen darüber, wie die Teilnehmer digitale Geräte nutzten. Es ist daher unklar, welche Anwendungen geistig anregend wirken oder wie viel Zeit nötig ist, um einen positiven Effekt zu erzielen. Anderson wies darauf hin, dass die Dauer der Bildschirmzeit nicht gemessen wurde – man weiß also nicht, ob es einen schädlichen Schwellenwert gibt.
Sachdev erklärte, wie schwierig es sei, die Wirkung einzelner Technologien zu isolieren, da die digitale Reizüberflutung heute extrem hoch ist. Anderson ergänzte, dass zukünftige Generationen andere Ergebnisse zeigen könnten, da sie von Geburt an mit Technik aufwachsen. Frühere Generationen mussten sich den Zugang zu digitalen Geräten noch mühsam erarbeiten.
Benge merkte an, dass die untersuchten Senioren bereits ein ausgereiftes Gehirn hatten, bevor sie in die digitale Welt eintauchten – das sei entscheidend für die Interpretation der Ergebnisse.
Geistige Anregung und soziale Verbundenheit als Schutzfaktoren
Die Ergebnisse stützen eher die Theorie der kognitiven Reserve als die der digitalen Demenz. Diese Theorie geht davon aus, dass komplexe Denkleistungen das Gehirn widerstandsfähiger gegen Altersveränderungen machen. Sachdev betonte, dass Technik geistige Aktivität fördern könne. Darüber hinaus erleichtert sie oft soziale Kontakte, deren Fehlen mit einem höheren Demenzrisiko verbunden ist.
Möglich sei auch, dass geistig fitte Menschen eher zu Technik greifen – das könnte den Zusammenhang erklären.
Konkrete Empfehlungen zur besten Nutzung digitaler Geräte gibt die Studie zwar nicht. Anderson unterstrich jedoch, dass eine gesunde Mischung aus Aktivitäten am förderlichsten sei – eine Erkenntnis, die sich auch in anderen Studien wiederfinde. Sachdev erklärte, digitale Beschäftigung solle Freude, Kreativität und geistige Anregung bringen – dann sei sie sinnvoll.
Bei Beschwerden wie Augen- oder Nackenverspannungen sei das ein Hinweis auf Übernutzung. Wichtig sei, einen Zweck zu definieren und dann die Nutzungsdauer gezielt zu gestalten, riet Sachdev.
Manche ältere Menschen meiden Technik, weil sie ihnen zu schwer erscheint. Doch Scullin und andere fanden heraus, dass selbst Personen mit leichter Demenz den Umgang mit Geräten erlernen können. Die anfängliche Frustration sei dabei Teil des geistigen Trainings – und genau das sei wertvoll für das Gehirn.